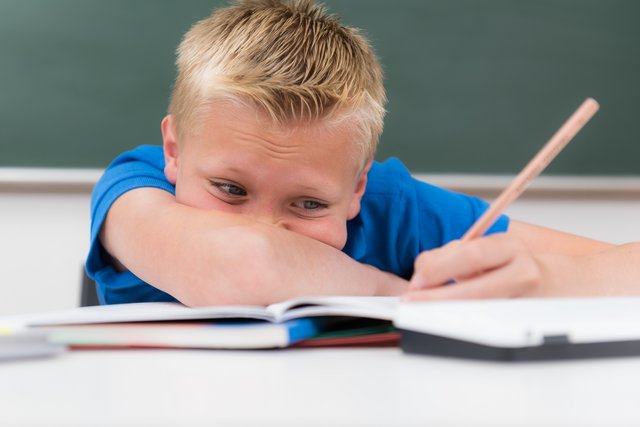Ich bin Petra Jakob, …
seit dem Jahr 2018 habe ich mich nach vielen Jahren der Tätigkeit als Lehrerin an öffentlichen Schulen mit meiner Praxis für Entwicklung und Lernen in Neukirchen-Vluyn selbstständig gemacht. Hier habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen auf ihrem Weg zum Lernerfolg und in ihrer persönlichen Entwicklung ganz individuell zu unterstützen und zu begleiten.
Schwerpunktmäßig widme ich mich der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lernproblemen, insbesondere bei Lese- und Rechtschreibschwäche.
Durch meine langjährige Erfahrung als Lehrerin an verschiedenen Schulformen und meine Expertise als Fachkraft für die Unterstützung von Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) bringe ich umfassendes Wissen und Einfühlungsvermögen in meine Arbeit ein. Mich begeistert es, Kindern (wieder) Freude am Lernen zu ermöglichen.
Zusätzlich zu meiner pädagogischen Erfahrung habe ich mich auch auf die Bereiche Reflexintegration und professionelle Kinesiologie spezialisiert. Diese unterschiedlichen Ansätze ermöglichen es mir, individuell auf die Probleme und Bedürfnisse meiner Klienten einzugehen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen.
In diesem Sinne arbeite ich auch mit Erwachsenen am Umgang mit individuellem Stress (z. B. Prüfungsangst) und auf Ihren Weg zu Vitalität, Wohlbefinden und Lebensfreude.
Ich lade Sie herzlich ein, mehr über meine Arbeit und die Möglichkeiten der Unterstützung zu erfahren. Gemeinsam können wir bestehende Herausforderungen überwinden.

Mein Angebot
Aktuelle Themen
Sie haben Fragen zu meiner Arbeit oder möchten einen Termin vereinbaren?
Dann können Sie das Kontaktformular nutzen oder Sie rufen mich an!
Ich freue mich darauf von Ihnen zu hören!